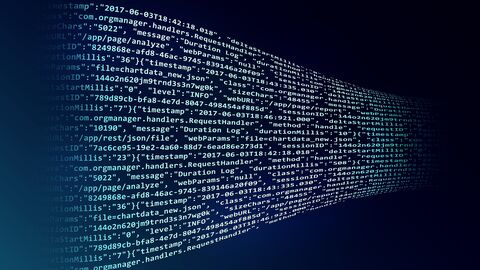Die elektronische Patientenakte (ePA) soll wichtige medizinische Informationen von Patienten lebenslang an einem Ort versammeln und so eine bessere Versorgung ermöglichen. Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen und Patienten können dadurch einen besseren Überblick über Diagnosen, Befunde und Medikation erhalten. Zudem soll die ePA auch die Forschung erleichtern, sodass Patientinnen und Patienten schneller von medizinischen Innovationen profitieren können.
Am 15. Januar 2025 ist in den Modellregionen Franken, Hamburg und Umland sowie in Teilen NRWs die Pilotphase für die ePA gestartet. Rund 300 Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser nehmen daran teil und testen die ePA. Ziel ist es zu prüfen, ob die ePA in der Anwendung sicher und zuverlässig läuft.
Erst nach erfolgreichem Abschluss der Pilotphase soll die ePA für alle bundesweit ausgerollt werden. Alle Leistungserbringer müssen sie dann verpflichtend nutzen.
Im Folgenden sind die gängigsten Fragen zur ePA aufgelistet. Die Antworten entsprechen dem aktuellen Stand und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie sollen Patientinnen und Patienten bei der Entscheidung helfen, ob und in welchem Umfang Sie die ePA mit Ihren persönlichen Gesundheitsdaten befüllen wollen oder ob Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen.
Stand: 10.02.2025