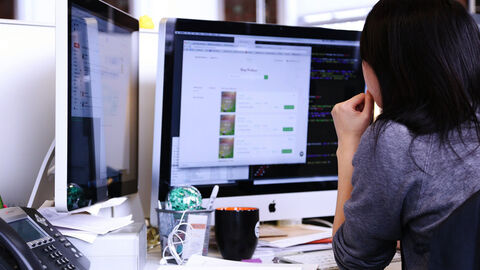Das Auskunftsrecht betroffener Personen gemäß Art. 15 Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) stellt Kommunen in der Praxis vor teilweise große Herausforderungen. Die nachfolgenden Hinweise in der folgenden Handreichung sollen insbesondere kleineren Städten und Gemeinden die Erfüllung dieses komplexen Anspruches erleichtern. Sie ergänzen die Handreichung „Datenschutz in Kommunen“, welche die grundlegenden Anforderungen des Datenschutzes erläutert.
Stand: 29.10.2025